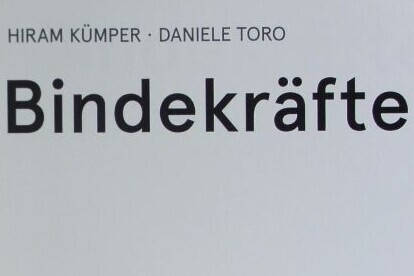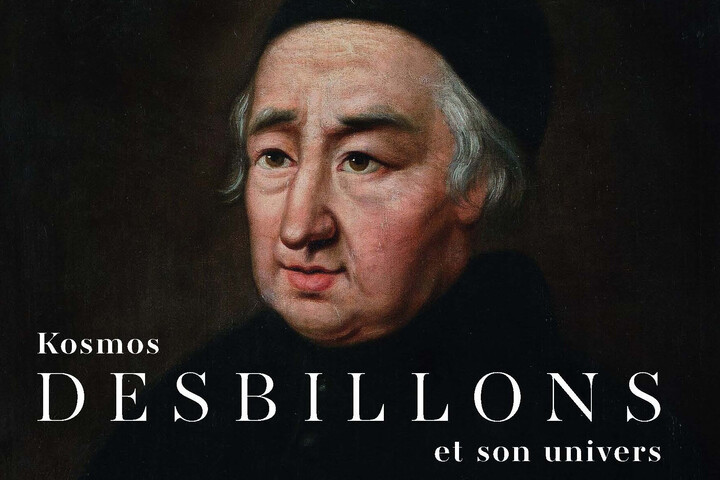Forschung
Am Lehrstuhl forscht ein lebhaftes Team – oft in drittmittelgeförderten Projekten oder Kooperationen mit anderen Hochschulen und außeruniversitären Institutionen. In den letzten Jahren haben wir uns als ein verlässlicher Partner in der Aufarbeitung historischer Überlieferung in ganz unterschiedlichen Formaten etabliert. Darauf sind wir stolz und freuen uns auf zukünftige Zusammenarbeit.
Forschungsschwerpunkte
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Stadt und ländlichem Raum

Einen Schwerpunkt unserer Lehrstuhlarbeit, der sich nicht nur etwa mit der Stadt- und Ortsgeschichte, sondern mit dem gesamten Profil der Universität fruchtbar verbindet, ist die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vormoderne.
Unsere Aktivitäten in diesem Bereich betreffen vor allem
- die Erforschung vormoderner Kreditmärkte, insbesondere von Kleinkrediten und ihrer Bedeutung für die Marktteilhabe größerer Teile der Gesellschaft;
- die Geschichte der Hanse und des norddeutschen Handels;
- die Erfassung vormoderne Wirtschaftsdaten und der damit verbundenen methodischen Fragen, insbesondere unter den Vorzeichen der Digitalisierung;
- die Branchen- und Unternehmensgeschichte, insbesondere in der Vor- und Frühindustrialisierung.
Im Rahmen des DFG-Projekts Kleinkredit und Marktteilhabe im Spätmittelalter befasst sich das Dissertationsvorhaben von Monika Gussone mit Klein- und Kleinstkrediten in nordwestdeutschen Städte.
Seit 2019 befasst sich der Arbeitskreis „Vormoderne Wirtschaftsdaten“ (gefördert von der Karin Islinger-Stiftung) am Lehrstuhl mit der Frage, wie unter den Bedingungen digitaler Kollaboration und Nachnutzung Daten zukünftig erhoben und im Sinne des Open-Data-Gedankens zur Verfügung gestellt werden können.
In allen unseren Aktivitäten arbeiten wir eng zusammen mit Archiven, Bibliotheken und insbesondere den Kolleg*innen an den Lehrstühlen von Prof. Annette Kehnel und Prof. Jochen Streb.
Stadt- und Ortsgeschichte(n)
Kommunales Erbe bewahren und zugänglich machen
Den besonderen Platz, den Städte in der europäischen Geschichte einnehmen, verdanken sie wesentlich ihren Wurzeln in einem gemeinsamen kommunalen Wir-Gefühl und dessen ostentativer Inszenierung. Heute ist das vielerorts verloren gegangen. Gerade zu den großen Jubiläumsjahren aber sehen wir es stets wieder auflodern. Rückbesinnung auf die eigene Geschichte ist wichtig für die Selbstverortung in der Gegenwart – und kann viele Einsichten für Visionen über die Zukunft liefern.
In den letzten Jahren haben wir am Lehrstuhl viel Erfahrung im Umgang mit städtischer Erinnerungskultur gesammelt: insbesondere mit Blick auf die vorindustrielle Zeit, auf Erstnennung, Markt- und Stadtrechtsprivilegien, auf frühen Aufschwung und manchmal auch auf längst vergangenen Glanz. Wir entwickeln gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen und des Kultur- und Vereinslebens Projekte und Konzepte, damit das städtische Erbe bewahrt und zugänglich gemacht wird – mal im Großen mit Chronikeditionen und Urkundenbüchern, mal im ganz Kleinen mit Broschüren, Ausstellungsprojekten, Kunstdenkmalführern und Vorträgen. Immer wieder sind dabei auch Studierende mit ihren frischen Ideen mit von der Partie.
Können wir Ihnen mit unserer Expertise helfen? Sprechen Sie uns gern an!
Mannheim und der deutsche Südwesten

Stadt-, Regional- und Landesgeschichte
Der Stiftungsauftrag der »Carl-Theodor-Professur« ist für uns Programm. Einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit am Lehrstuhl machen entsprechend die Region und insbesondere die Stadt Mannheim aus. Denn was wäre die Universität ohne das Mannheimer Barockschloss, in dem sie beheimatet ist? Und was wäre ein Barockschloss ohne eine Frühneuzeitforschung, die sich dafür zuständig fühlt? In zahlreichen Kooperationen mit dem Stadtarchiv (MARCHIVUM), dem Mannheimer Altertumsverein und den Museen vor Ort arbeiten wir an diesem kulturellen Erbe.
Als ehemalige Residenzstadt hat Mannheim eine besondere Beziehung zur Kurpfalz – ein Territorium, dessen historische Ausdehnung sich über mehrere heutige Bundesländer erstreckt. Geforscht wird zur kurpfälzischen Geschichte wie auch zur Geschichte der Nachbarterritorien, etwa Badens, Württembergs oder des (Fürst-)Bistums Speyer.
Ein größeres Projekt, das wir in den nächsten Jahren verfolgen wollen, ist eine Verwaltungsgeschichte der Kurpfalz von der Erbteilung 1410 bis zur Auflösung und zum Übergang an Baden im Reichsdeputationshauptschluss 1803.
Deutsche Rechtsgeschichte
Forschungsprojekte
Laufende Projekte
Kleinkredit und Marktteilhabe
DFG-Projekt zum spätmittelalterlichen Nordwesten
Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte arbeiten wir an dem von der DFG finanzierten Projekt Kleinkredit und Marktteilhabe (Förderzeitraum: 2018–2021, Forschung wird fortgesetzt).
Das Projekt erforscht Klein- und Kleinstkredite als fundamentale sozioökonomische Praxis spätmittelalterlicher Gesellschaften im europäischen Vergleich ausgehend von der These, dass gesellschaftliche Kohärenz u. a. über Marktteilhabe erzeugt wird, und diese wiederum wesentlich auf Schulden, Ausständen und gegenseitigen Verpflichtungen aufbaut. In drei in ihren leitenden Fragestellungen eng miteinander verknüpften historischen Fallstudien (England, Tirol, Nordwestdeutschland) zu spätmittelalterlichen Mikrokreditpraktiken soll diese These überprüft werden. Der Erforschung alltäglicher ökonomischer Verflechtungen stand bisher in erster Linie ein massives Überlieferungsproblem im Wege, weil gerade kleine und kleinste Transaktionen durch ihren geringen Sachwert wenig Aufzeichnungs- oder Überlieferungschance haben. Diesem Problem begegnet das Forschungsprojekt mit der Heranziehung neuer Quellengruppen, die bislang in diesen Kontexten noch wenig oder gar keine Beachtung gefunden haben und zum Großteil nicht direkt, sondern nur mittelbar den Blick auf solche Klein- und Kleinstkredite sowie die damit gestifteten sozialen Gemeinschaften freilegen.
Für Einzelheiten besuchen Sie die Projekt-Website.
Lviv in der frühen Neuzeit
Handbuchprojekt über eine multikulturelle Stadt
Das frühneuzeitliche Lviv/
Lemberg war eine Stadt an der Schnittstelle zwischen mehreren Kulturen. Exzeptionell reich ist auch die Überlieferung dieser Zeit. Im Projekt erarbeitet ein internationales Team ein Handbuch, das den Weg zu dieser Überlieferung ebnet, um weitere Forschungen anzuregen. Laufzeit: 2019 bis 2024
Projektleitung: Prof. Dr. Hiram Kümper | Dr. Jakub Wysmułek (Polnische Akademie der Wissenschaften, Warschau)
Projekthomepage & Fellows: ► hier
Kooperationspartner: Lviv Center for Urban History of East Central Europe
Nachlass Sepp Herberger
Dokumente zur Sport- und Zeitgeschichte
Der ungemein umfangreiche Nachlass des Reichs- und Bundestrainers Josef »Sepp« Herberger (1897–1977) zählt zu den erstrangigen Privatnachlässen der deutschen Sportgeschichte. Er wird im Archiv des Deutschen Fussball-Bundes in Frankfurt a. M. als Depositum der Sepp-Herberger-Stiftung verwahrt. Mit Unterstützung der Stiftung wird am Lehrstuhl über die nächsten Jahre eine mehrbändige Ausgabe mit thematischen Querschnitten durch den Nachlass erarbeitet.
Band 1 mit den Fragmenten zur nie fertig gestellten Autobiographie ist 2023 unter dem Titel »Herberger über Herberger« erschienen.
Der zweite Band, der die Korrespondenz mit den Nationalspielern erschließt, soll um den Jahreswechsel 2024/
25 fertig gestellt werden. Publikationen: Hiram Kümper (Hg.), Herberger über Herberger. Herberger: der Nachlass, erster Band. Heidelberg 2023.
Die Nordhäuser Siegelsammlung: Sphragistik digital
Mit künstlicher Intelligenz und bürgerwissenschaftlichem Engagement
Gemeinsam mit dem Stadtarchiv Nordhausen, dem Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein, dem Mitteldeutschen Archivnetzwerk und dem Universitätsarchiv Leipzig wurde die Nordhäuser Siegelsammlung digitalisiert und für die bürgerschaftswissenschaftliche Erschließung fit gemacht. Das beinhaltet ein Annotationsportal und umfangreiche Hilfestellungen bei der Beschreibung von Siegeln, die individuell und autodidaktisch oder in der gemeinsamen Gruppenarbeit genutzt werden können.
- Nordhäuser Siegelsammlung: Einstiegsseite und das Annotationsportal mit sämtlichen Siegelimages
- Gemeinsam mit Dr. Miriam Weiss (MW Pädagogik) sind zur Unterstützung der bürgerwissenschaftlichen Arbeit Erklärvideos auf unserem YouTube-Kanal entstanden.
- Katharina Prasse hat in einer Pilotarbeit erstmal Methoden der Image Recognition für die massenhafte Sortierung von Siegel-Image-Dateien angewandt. Der Source-Code ist Open Source und steht gemeinsam mit einer eingehenden Dokumentation auf Github zur Verfügung.
Gefördert wurde das Gesamtvorhaben von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Förderprogramms WissensWandel.
Hanserezesse der Neuzeit und Wendisches Inventar
Die Überlieferung der hansischen Spätzeit
Gemeinsam mit den Stadtarchiven des alten Wendischen Viertels entsteht ein digitales Inventar der späthansischen Überlieferung. Es schließt die Lücke der bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts erarbeiteten Inventarwerke für die anderen drei hansischen Quartiere. Daraus abgeleitet werden wesentliche Grundlagen für die noch immer ausstehende Edition der hansischen Rezesse nach 1535.
Publikationen:
- Nils Jörn, Archivalien zu den Hansekontoren im Archiv der Hansestadt Wismar – Vorstellung des Projektes eines Hansischen Inventars, in: Hansische Geschichtsblätter 132 (2014), S. 115–118.
- Hiram Kümper, Die Spätzeit der Hanse und ihr Blätterwald im digitalen Zeitalter: Über das Wendische Inventar und von interimistischen Rezesseditionen, in: Nils Jörn/Jürgen Sarnowky (Hgg.), Der Hansische Geschichtsverein und die Hansegeschichtsforschung seit dem 19. Jahrhundert (Hansische Studien 33), Wismar 2024 (im Druck).
Territoriale Raumbild(n)er
Wie Geschichte sich in Landschaft versenkt
Als Partner im DFG-Projekt »Territoriale Raumbild(n)er: Historische Landschaftsbezüge als politische Herausforderung« erforschen wir gemeinsam mit Prof. Dr. Susanne Kost die Wirksamkeit historischer Raumbilder für die Gegenwart und Zukunft in den beiden Untersuchungsräumen Lippe und Ostfriesland.
Im Oktober 2019 wurde im Rahmen des Forschungsprojekts eine Exkursion mit Master-Studierenden nach Ostfriesland durchgeführt. Mehrere Workshops und Arbeitstreffen im Warburg Haus (Hamburg) sowie an den Universitäten Mannheim und Hamburg begleiteten das Projekt.
Publikationen:
- Susanne Kost, Julia Wittmann, »Und da hört für mich die zivilisierte Welt auf«: Historische Bezüge mentaler Raumkonstruktionen, in: ZEITARBEIT 2/
2021, S. 8–22. - Hiram Kümper, Tiefenbohrungen: Raumbilder als regionale Ressource in den Sedimenten der Zeit, in: Sarah Hübscher, Christopher Kreutchen (Hg.), Contact Zone – ein Prinzip der »guten Nachbarschaft«. Festschrift für Barbara Welzel, Bönen 2021, S. 302–307.
- Susanne Kost, Julia Wittmann, »Und da hört für mich die zivilisierte Welt auf«: Historische Bezüge mentaler Raumkonstruktionen, in: ZEITARBEIT 2/
Kalkarer Urkundenbuch
Regesten und Volltexte zur Stadtgeschichte bis 1500
Kalkar gehörte während des Mittelalters und bis weit in das 16. Jahrhundert hinein zu den bedeutendsten Städten des Herzogtums Kleve-Jülich bzw. der vereinigten Herzogtümer Kleve-Jülich-Berg. Im Stadtarchiv haben sich rund 1.000 Urkunden erhalten, die von dieser Bedeutung Zeugnis ablegen. Ediert ist von diesem reichen Bestand bisher nur ein einstelliger Prozentsatz, verstreut über teils entlegend erschienene Publikationen.
Seit 2013 entsteht in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Kalkar der erste Band eines längst überfälligen Kalkarer Urkundenbuchs. Er umfasst die rund 400 mittelalterlichen Urkunden bis zum Jahr 1500. Eine anschließende Weiterführung des Projekts, um in einem zweiten Band auch die Urkunden des 16. und 17. Jahrhunderts zugänglich zu machen, steht derzeit noch unter Finanzierungsvorbehalt.
Zeitweilige Projektmitarbeiter(innen) und Honorarkräfte: Jasmin vom Brocke, M.A. | Jan Siegemund, M.A. | Dr. Christoph Walther | Marieke Weiss, M.A.
Ermöglicht durch die freundliche Förderung der Heresbach-Stiftung (Kalkar).
Predigten des Johannes Nider OP
Edition
Das Projekt unternimmt die Edition der „Großen Predigtsammlung” des Johannes Nider OP († 1438), eines der sicherlich faszinierendsten Denker der dominikanischen Ordensprovinz Teutonia im 15. Jahrhundert. Er legte nicht nur zu im engeren Sinne theologischen, sondern auch zu ganz unmittelbar gesellschaftspolitischen, beispielsweise zu wirtschaftsethischen Fragen bemerkenswerte Stellungnahmen vor. Seine Bedeutung in der kirchen- und geistesgeschichtlichen Forschung ist entsprechend unbestritten. Insbesondere sein berühmtes (mitunter auch berüchtigtes) Prediger- und Erbauungsbuch Formicarius und sein Traktat über die Verträge der Kaufleute (De contractibus mercatorum) werden immer wieder bemüht.
Niders umfassendes Predigtwerk hingegen wird stets nur ausschnittsweise herangezogen – vor allem, weil bis heute eine Textausgabe fehlt. Das will das Projekt ändern und die kraftvollen, geistesgeschichtlich hochinteressanten Predigten Johannes Niders endlich der forschenden Öffentlichkeit zugänglich machen. Als Grundlage dienen dabei die beiden überlieferten Handschriften der „Großen Predigtsammlung“ (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. Germ. qu. 1593 und München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 3891) sowie punktuell weitere Überlieferungsträger von Einzelpredigten.
Projektstand: Transkription und Kollation sind abgeschlossen. Wir arbeiten an Korrektur, Kommentierung und Einleitung.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Dr. Marco M. Wagner | Kira Keßler, M.A.
Das „Rauhe Buch“ der Stadt Nordhausen
Edition und Übersetzung
Als Stadtbuch dokumentiert und untermauert das „Rauhe Buch“ vor allem den Ausbau der städtischen Autonomie und der Herrschaft des Rates der Reichsstadt Nordhausen am Harz (Stadtarchiv Nordhausen, 1.2 II Na 17). Es wurde im Jahr 1350 angelegt, der weitaus größte Teil betrifft noch das die mittelalterliche Blütezeit der Stadt im 14. Jahrhundert. Bis weit in das 16. Jahrhundert wurde es fortgeführt, letzte Nachträge stammen aus dem Jahr 1660.
Es handelt sich um ein Kopialbuch, ein Stadtbuch gemischen Inhalts, in das Abschriften der städtischen Privilegien und sonstigen Urkunden bezüglich der Rechte, Besitztümer und Finanzen der Stadt eingetragen wurden. Darunter befinden sich Privilegien der Könige und Kaiser, verschiedener weltlicher Herren und Bischöfe, Verordnungen und Vereinbarungen des Stadtrates, auch mit Klöstern, Zünften und diversen Einzelpersonen. Darüber hinaus finden sich Eidesleistungen städtischer Hauptmänner, Schlichtungen und Gerichtsbeschlüsse, Reglementierungen gegen Fälschungen der beliebten Nordhäuser Tücher und eine Verordnung gegen illegales Bierbrauen. Einblicke in das städtische Finanzwesen ermöglicht eine von 1360 bis 1371 reichende Liste von städtischen Zinsbriefen.
Nicht nur zu Fragen städtischer Politik, Ereignisgeschichte und Identität wird man im „Rauhen Buch“ fündig. Die Quelle eröffnet unter anderem auch Aspekte der örtlichen Rechts-, Alltags-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der lokalen Sprach- und Namensentwicklung, der Geschichte der Nordhäuser Juden, der besonderen Stellung einer Reichsstadt und der Geschichte des Umlands. Das Buch eröffnet damit ein facettenreiches Panorama städtischen Lebens insbesondere des 14. und 15. Jahrhunderts.
Bislang liegt nur ein Teil der Dokumente gedruckt vor, in verschiedenen älteren Arbeiten unterschiedlicher Qualität. Das Projekt widmet sich der Edition dieser interessanten Handschrift erstmals als Ganzes und übersetzt die lateinischen Textteile, um das Buch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Dr. des. Daniela Bianca Hoffmann
Ermöglicht durch die freundliche Förderung der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung.
Regesten der Urkunden von Haus Letmathe
Erschließung eines westfälischen Adelsbestandes
In diesem gemeinsam mit dem Stadtarchiv Iserlohn durchgeführten Projekt entsteht ein Regestenwerk der rund 500 aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit überlieferten Urkunden des westfälischen Adelshauses Letmathe.
Ein Großteil dieser Urkunden befindet sich heute im Iserlohner Stadtarchiv, weitere Teilbestände in Graz und Viersen. Die Regesten sollen nach Projektabschluss über die Digitale Westfälische Urkunden-Datenbankdes LWL-Archivamts abrufbar sein. Das Projekt geht ebenfalls einher mit einer umfassenden Neuverpackung der Letmather Urkunden im Stadtarchiv Iserlohn.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Daniele Toro, M.A. | Christina Sprick, M.A.
Verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut im Bestand der Universitätsbibliothek Mannheim
Gefördert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste sollen die unter den Verfolgungen des NS-Regimes von ihren Besitzer*innen entweder unter Druck oder durch offenes Unrecht in neue Hände und – teils über Zwischenwege – an die Universitätsbibliothek gelangten Buchbestände identifiziert werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebsite sowie in der Pressemitteilung der Universität Mannheim.
Projektbearbeiter: Dr. Max Gawlich
Projektleitung: Viktor Boecking M.A. | Dr. Sandra Eichfelder | Prof. Dr. Hiram Kümper
Laufzeit: 2024–2025
Abgeschlossene Projekte
Rintelner Urkundenbuch
Rintelner Urkundenbuch: die städtischen Urkunden bis 1500
Die Edition der städtischen Urkunden Rintels bis zum Jahr 1500 wurde, unterstützt vom Stadtarchiv Rinteln und der Historischen Arbeitsgemeinschaft für Schamburg, von Hiram Kümper gemeinsam mit Kolleg*innen erstellt; bearbeitet und herausgegeben sowie durch Überlieferung aus dem Bückeburger Landesarchiv ergänzt wurde das Manuskript von Archivdirektor a.D. Dr. Hubert Höing.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Dr. Hubert Höing
150 Jahre Mannheimer Rheinakte
Vor 150 Jahren gelang es, durch die Revidierte Mannheimer Rheinakte endgültig die Freiheit der Flussschifffahrt auf dem Rhein zu schaffen. Nach jahrhundertelangem Streit um Vorrechte und Einflussnahmen und einem zähen Ringen um die letzten Zölle und Stapelprivilegien konnte so eine einheitliche Verwaltung und Rechtsprechung und eine gemeinsame Pflege des Stromes und seiner Uferläufe erreicht werden. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, die diese Akte ausgearbeitet hat und umsetzt, gilt bis heute als beispielhaft für internationale Organisationen im Bereich wirtschaftlicher, administrativer und politischer Zusammenarbeit.
Die Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Revidierten Rheinschifffahrtsakte vom 17. Oktober 1868 versammelt elf Beiträge rund um diesen Meilenstein der Binnenschifffahrt und bietet auch ein Faksimile der Mannheimer Akte. Die Publikation ist auch als E-Book verfügbar.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Prof. Dr. Andreas Maurer
Südwestfälische Kettenproduktion
Fünf Jahrhunderte südwestfälische Kettenproduktion: eine Branchengeschichte in der longue durée
Die Kettenherstellung prägte über lange Zeit das Wirtschaftsleben des südlichen Westfalens stark. Aus dem Projekt ging die erste umfassende Geschichte dieses Handwerks- und Industriezweiges vom späten 17. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit hervor. Dabei werden Ansätze einer modernen Wirtschafts- und Regionalgeschichte, interregionale Verflechtungen, Infrastruktur- und Ressourcenfragen mit der Beobachtung sozialer und kultureller Muster verbunden. Neben der Geschichte von Technik, Nutzung und Handel wird die Kette als zentrales Identifikationsobjekt einer Landschaft längs der „Eisenstraße” untersucht.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Daniele Toro, M.A.
Publikation: Hiram Kümper/Daniele Toro, Bindekräfte. Fünf Jahrhunderte südwestfälische Kettenproduktion. Iserlohn 2021.
Biographie Ernst Erhardt
Ernst Ehrhardt (1855–1944): ein Architektenleben zwischen Preußen und Bremen
Der Architekt Ernst Ehrhardt begleitete und prägte als Dombaumeister, früher Denkmalschützer und nicht zuletzt auch als Kulturhistoriker das Bremen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weitere Orte seines reichen Schaffens sind Berlin, Sankt Petersburg, Schleswig, Emden und das Elsass. Das Projekt widmet sich der Edition und Kommentierung der handschriftlichen Memorien Ehrhardts. So entsteht ein facettenreiches Bild deutscher Architektur- und Kulturgeschichte.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Dieter Wegener (†) | Sascha vom Brocke
Letmather Ortsgeschichte
Als zeitweise eigenständige Stadt erfüllte Letmathe durch die Epochen hindurch eine wichtige Zentralortfunktion für die Region: Erst als Herrschaftssitz, später als Industriestandort, vor allem in der Metallindustrie. Eine neue Ortsgeschichte soll eine moderne Gesamtdarstellung des Letmather Raumes bieten und erstmals die Entwicklungen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts vollständig miteinbeziehen. Die Geschichte der Siedlung an der Lenne wird so von den geologischen Ausgangslagen, ihrer Archäologie und Urgeschichte ausgehend über die Jahrhunderte bis in die jüngste Gegenwart facettenreich erzählt. Es entsteht ein breites und abwechslungsreiches Bild von einer sich stets im Wandel befindenden Stadt und ihrer Bedeutung für die Region. Geplant sind zwei Bände: Band 1: Von den Dinos bis zur Dampflok; Band 2: Vom Kiettenknüpper bis Covid.
Bearbeiter: Prof. Dr. Hiram Kümper | Daniele Toro M.A.
Publikation: Kümper, Hiram/
Toro, Daniele (Hrsg.), Letmathe. Stadt, Land, Menschen durch die Jahrhunderte. 2 Bde. Erscheint im Oktober 2024.
Qualifikationsarbeiten
Laufende Promotionsprojekte
- Viktor Boecking, M.A.: Stadthaushalt und Privatvermögen in Arnstadt zwischen der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg (E-Mail)
- Mechthild Fischer, M.A.: Französisch-deutscher Kulturaustausch auf der Bühne und zwischen Buchdeckeln: Drucker, Händler und Publikum im Mannheim des 18. Jahrhunderts (E-Mail) | » Vortragsmitschnitt vom 20.1.2017 (Univ. Heidelberg)
- Philipp Gros, M.A.: Wirtschaftsarchäologie der Kurpfalz, 17. bis 19. Jahrhundert.
- Monika Gussone, M.A.: Kleinkredit und Marktteilhabe im deutschen Nordwesten: Wesel, Kalkar und Bocholt im späten Mittelalter
- Gernod Jungcurt: Autorité, Pouvoir, Puissance: Begriffsstudien zur französischen Verfassungsgeschichte (E-Mail)
- Kira Keßler, M.A.: Kindheit und Jugend in totalen Institutionen. Eine Fallstudie zu Kleve und Mark (18./19.Jhd) (E-Mail)
- Lena Lizernski, M.A.: Menschen, Geld und Märkte: das Leben und Wirtschaften der kleinen Leute in Speyer im 16. Jahrhundert (E-Mail)
- Christina Röhrenbeck, M.A.: Das kurpfälzische »Dominium Rheni« am nördlichen Oberrhein.
- Maike Sambaß, M.A.: Der badische Ringtausch 1934/
1935 und seine Folgen für die Museumslandschaft im deutschen Südwesten. - Maximilian Scheler, M.Ed.: Das antireformatorische Werk des Daniel Agricola (ca. 1490–1540)
- Simon Sosnitza, M.A.: Die niederdeutsche Bearbeitung der Weltchronik des Dietrich Engelhus (E-Mail)
Abgeschlossene Promotionen
Abgeschlossene Promotionen
- Dr. Marco Michael Wagner: Das Elementarschulwesen in der Kurpfalz, 1556–1803. (2016)
- Dr. Christina Fehse: Rintelner Weserzölle, 1571–1621: eine Studie zum norddeutschen Transithandel. (2020)
- Dr. Sarah Pister: Stadtfremde in Mannheim: Zur Aufnahme und Integration von In- und Ausländern in eine landesherrliche Stadt des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. (2020)
- Dr. Laura Wiedebusch: Die Entwicklung der Ulmer Lateinschule in der Frühen Neuzeit. (2022)
- Dr. Francesco Giuliani: The Congregation of the Council and the Praxis of the Decree De rebus regularium non alienandis in the Papal States (Marche XVIIth c.)(2023)
Publizierte Master- und Bachelorarbeiten
- Pister, Sarah: 1778–1815: Bescheidene Zuwanderungsgewinne. Maßnahmen zur Migrationssteuerung im Übergang zum 19. Jahrhundert, in: Philipp Gassert, Ulrich Nieß, Harald Stockert (Hg.), Zusammenleben in Vielfalt: Zuwanderung nach Mannheim von 1607 bis heute (Veröffentlichungen zur Mannheimer Migrationsgeschichte 1), Ubstadt-Weiher 2021, S. 94–109.
- Böckle, Verena: Die Grundherrschaft des Aachener Marienstifts in Erkelenz-Bellinghoven, 1500–1634: Transkription und Kommentar zum historischen Quellenwert spätmittelalterlicher Lehnsregister, in: Geschichte im Bistum Aachen 15 (2019/20), S. 87–122.
- Piechotta, Max: Ein Museum gegen die DDR: Die Vorgeschichte und Anfänge des „Vereins zur Darstellung der Deutschen Sozialgeschichte“, in: Mannheimer Geschichtsblätter 40 (2020), S. 48–61.
- Bischoff, Max-Quentin: Leichenpredigten: Leben und Sterben in der Frühen Neuzeit, in: Zeitarbeit. Aus- und Weiterbildungszeitschrift für die Geschichtswissenschaften 1 (2019), S. 56–58.
Master- und Zulassungsarbeiten (M.A. | M. Ed.)
- The Shrovetide and the Tournament: A Study of the Correlation Between Courtly Traditions and Carnival in Late Medieval Germany
- Hexenprozesse vor dem Reichskammergericht in Speyer
- Die Gebetssammelhandschrift des Johannes Houwenschilt (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. brev. 108): Messvorbereitungs- und Kommunionsgebete im Spiegel spätmittelalterlicher Frömmigkeit. Edition und Analyse
- Oskar Halecki – Profil eines Europahistorikers
- Der erste Kreuzzug in der deutschen Historiographie des 16. und 17. Jahrhunderts
- Germanistische Rechtsgeschichte und deutsche Nationalbewegung 1806 bis 1849
- Chronica Mündensis: Edition und Kommentar einer unbekannten Stadtchronik von Hannoversch Münden aus dem frühen 17. Jahrhundert
- Mannheims große Zeit: eine Marketingstudie zum touristischen Potenzial der »Carl-Theodor-Zeit«
- Einrichtung und Aufbau der Amerikawissenschaft an der Kölner Universität nach dem Zweiten Weltkrieg. (zus. mit Jun.-Prof. Isabel Heinemann/
Münster) - Archivalische Quellen zur Personengeschichte von Schwäbisch Hall im 15. bis 17. Jahrhundert: eine Sichtung der reichsstädtischen Bestände im Stadtarchiv
- Frauenheilkunde im 18. Jahrhundert: gynäkologische Literatur in der Bibliothek des Vereins für Naturkunde und der ehemaligen Geburtshelferinnenschule Mannheim
- Mannheimer Fremdenlisten: Aufbereitung und Auswertung der in Mannheim ankommenden und durchreisenden Fremden anhand des »Mannheimer Intelligenzblattes« (ausgezeichnet mit dem Preis der Stiftung für Medien- und Kommunikationswissenschaften)
- Städtische Wirtschaft und Finanzmanagement im Spätmittelalter: das Beispiel der Bocholter Stadtrechnungen (ausgezeichnet mit dem Andreas-Lamey-Preis der Philosophischen Fakultät 2017)
- Der Verein für die Erforschung der deutschen Sozialgeschichte: ein museales Projekt und seine Folgen
- Das Volk der Osmanen im Blick der Memoiren des Louis »Pascha« Kamphövener (Schleswig, Landesarchiv, Abt. 399, Nr. 26): eine Fallstudie zum deutschen Orientalismus
- Der Haushalt der Stadt Arnstadt an der Wende vom 16. auf das 17. Jahrhundert
- Mannheim als Reiseziel im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
- Gymnasialunterricht im Zeitalter der Aufklärung: Die Ulmer Schulordnung von 1740. Nach der Handschrift AV 1026 der Stadtbibliothek Ulm
- Kaufmannsliteratur im Übersetzungsprozess: zur Rezeption niederländischer und spanischer Kaufmannsbücher im Deutschland der frühen Neuzeit
- Die Eingliederung des Elsass in das Deutsche Reich: Kriegszieldiskussion deutscher Geschichtsprofessoren von 1870 und die Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg bis 1909
- Mittelalterliche Makulatureinbände im Altbestand der Universitätsbibliothek Mannheim
- Frau Natters Salon: eine Studie zur bürgerlichen Objektkultur anhand von Mannheimer Verlassenschaftsakten. (ausgezeichnet mit dem Franz-Schnabel-Preis des Mannheimer Altertumsvereins)
- Die Görzer Bergordnung von 1486: Transkription und Kommentar nach der Handschrift 49 des Staatsarchivs Innsbruck
- Das Leben der Toten: Die Totenbücher von Schwäbisch Hall im 17. Jahrhundert
- Reallohn und Lebensstandard in Speyer in der Frühen Neuzeit: städtische Lebenshaltung anhand von Rechnungen der Elendsherberge, 1548–1605
- Reise in die Stadtgeschichte: Archivkoffer als Vermittlungsinstrument am Beispiel des Stadtarchivs Schwetzingen
- Die Stadt in ihren Dokumenten: Konzeption einer Archivalienausstellung zur Geschichte von Neuenhaus
- »viel wunderbarlicher gesichter und erschrecklicher fewerzeichen« – Quellenkritische, multiperspektivische Revision der Nordlicht-betrachtungen in der Datenbank Tambora.org
- Studien zum Rentenmarkt von Beckum im 15. und 16. Jahrhundert
- Schwarze Wämser und klassische Literatur: Besitz aus Inventaren Braunschweiger Bürger des 16. Jahrhunderts
- »Actum anno domini MCCC LXXII« – Eine Edition und Auswertung der Imbreviatur des Hainricus Moser von Meran aus dem Jahr 1372
- Lokalgeschichte für den gymnasialen Geschichtsunterricht: am Beispiel der Stadt Mosbach
- Getreidepreise in Neustadt an der Weinstraße: 16. bis 18. Jahrhundert
- Trachten als Ausdruck regionaler und kultureller Identität? Vergleich zweier Trachtenbücher aus dem 17. und 19. Jahrhundert: Marcus zum Lamm und Georg Maria Eckert
- Kindsmord in Mannheims 18. Jahrhundert: der Prozess gegen die Kindsmörderin Gertrude Kraemerin
- Kindstötung in der Kurpfalz im ausgehenden 18. Jahrhundert: auf Grundlage einer Sammlung kurpfälzischer Gerichtsfälle, 1760–1785
Bachelorarbeiten (B.A. | B. Ed.)
- Sachsenrecht am Niederrhein: eine vergleichende Analyse der Kalkarer Sachsenspiegelhandschrift (ausgezeichnet mit dem Claudia-Huerkamp-Preis der Universität Bielefeld)
- Wunderkammertourismus in der deutschen Renaissance: Heinrich Schickhardts Italienreise
- Lübecker Urfehdewesen im 15. Jahrhundert: auf Grundlage der überlieferten Urfehdebriefe des Historischen Archivs
- Der Auftrag: eine Analyse der Interaktion zwischen Künstler und Abnehmer. Am Beispiel des Pariser Kunstmarktes seit der Renaissance
- Legate an das Dienstpersonal in den Lübecker Bürgertestamenten des 15. Jahrhunderts (1400–1449): Begriffliche Probleme und Beziehungsverhältnisse (ausgezeichnet mit dem Andreas-Lamey-Preis der Universität Mannheim)
- Die Fugger in der Montanindustrie: der Ungarische Handel und der Tiroler Bergbau
- Taufe als interkultureller Code: nach portugiesischen Afrika-Berichten des 15. und 16. Jahrhunderts
- Studenten im Alten Reich: Mittelstadt und Mobilität (Einbeck, Kalkar, Erkelenz, 14.–16. Jahrhundert)
- Die Entwicklung der Schwarzen Häupter von Riga in der Zeit von 1416 bis 1477 unter besonderer Würdigung der Schrage von 1477
- Die Behandlung von Gewaltverbrechen in der »Summa totius Brodii« (nach der Handschrift Nordhausen, Stadtarchiv, Best. 1.2., II Nc 1) (ausgezeichnet mit dem Artes-Liberales-Preis der Universität Mannheim)
- Tagebuch und Briefwechsel des Johannes Brendell (Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. pal. germ. 791)
- Fürstliche Bürger und bürgerliche Fürsten: Eine vergleichende Analyse von Instabilitäten einer Republik durch strukturelle Faktoren an den Beispielen Polen-Litauen und Venedig
- Die Grundherrschaft des Aachener Marienstifts in Erkelenz 1500–1634: Transkription und Kommentar zum historischen Quellenwert spätmittelalterlicher Lehnregister (ausgezeichnet mit dem Andreas-Lamey-Preis der Universität Mannheim 2016)
- Franzosen in Mannheim: der Blick auf Stadt und Hof in ausgewählten Reiseberichten des 18. Jahrhunderts
- Geschäftsalltag eines Notars im 13. Jahrhundert: Auswertung eines savonischen Notariatsregisters
- Die Weinstraßen-Jubiläen. Über den Umgang mit Nazi-Monumenten am Beispiel der Deutschen Weinstraße
- Graphologie zwischen Hilfs- und Pseudo-wissenschaft: der schwierige Weg einer Disziplin im 20. Jahrhundert
- Die Bissinger Policey-Ordnung von 1603 – Was regelt Herrschaft in der frühen Neuzeit? Transkription und Untersuchung
- Zitronen in der höfischen Küche der Kurpfalz: Auswahltranskription und Untersuchung zu einem Mannheimer Kochbuch des 18. Jahrhunderts
- Die Bedeutung der Fischerei am Unteren Neckar vom 16. bis zum 19. Jahrhundert: ausgewählte Quellenbefunde
- Brot, Weck und Korn: die Getreide- und Brotpreise in Neustadt an der Weinstraße, 1700–1732
- Gerichtliche Konflikte im Neckerauer Dorfbuch: Transkription und Untersuchung
- Mannheimer Fleischtaxen, 1790–1818: anhand der »Mannheimer Intelligenzblätter«
- »Ein eingeborener Mut zur Selbständigkeit« – Untersuchung und Einordnung von Clara Denekes Memoiren im Stadtarchiv Iserlohn
- Zwischen alter und neuer Heimat: Erlebnisse einer Mannheimer Auswandererfamilie in Nordamerika (1849–1863) nach ihren Briefen
- Die Mannheimer Schifferzunft: anhand der Zunftordnung von 1730 und der Zunftprotokolle von 1774–1776
- Die »große Hungersnot« 1771/
72 in Oggersheim und den umliegenden Gemeinden - Werbung, Warnung und Wahrhaftigkeit: Deutsche Amerikamigration im 18. Jahrhundert im Zeichen von Schriften des Dafür und Dagegen
- Die Entwicklung des Hochschulsports an der Universität Mannheim: von einer Hochschule ohne eigenen Sportbetrieb zum größten Hochschulsportanbieter in der Region
- Einbettung regionaler Geschichte in den schulischen Geschichtsunterricht am Beispiel der Stadt Weinheim an der Weinstraße
- Das Repertoire des Mannheimer Nationaltheaters, 1781–1784, anhand der handschriftlichen Theaterzettel
- Hansischer Russlandhandel im 16. Jahrhundert: am Beispiel eines Sendschreibens aus dem Soester Stadtarchiv
- Die deutsche Auswanderung in das Russische Reich im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Lehnsbücher der Pfalzgrafen am Rhein Friedrich I. und Ludwig V.: eine Betrachtung der Beziehungen der Kurfürsten der Pfalz mit den Markgrafen von Baden in den Jahren 1458 bis 1509
- Traumland Amerika? Die Bedeutung von Briefen und privaten (Werbe)schriften für die pfälzische Amerikaauswanderung im 18. und frühen 19. Jahrhundert
- Die Präsidentschaftswahl 1804: zur Darstellung von Thomas Jefferson in den deutsch-amerikanischen Zeitungen »Der Readinger Adler« und »Der wahre Amerikaner«
- Die Rezeption der Sklaverei und Abraham Lincoln als Sklavenbefreier während des Amerikanischen Bürgerkrieges in den deutsch-amerikanischen Zeitungen »Hermanner Volksblatt« und »Richmonder Anzeiger«
- Die politische und gesellschaftliche Bedeutung von sozialen Medien in Bezug auf die Folgen der Iranischen Revolution 1979: eine Analyse anhand der #whitewednesdays-Kampagne
- Geschichte längst der S1: Kulturtourismus und Mobilitätskonzepte in der Nordpfalz