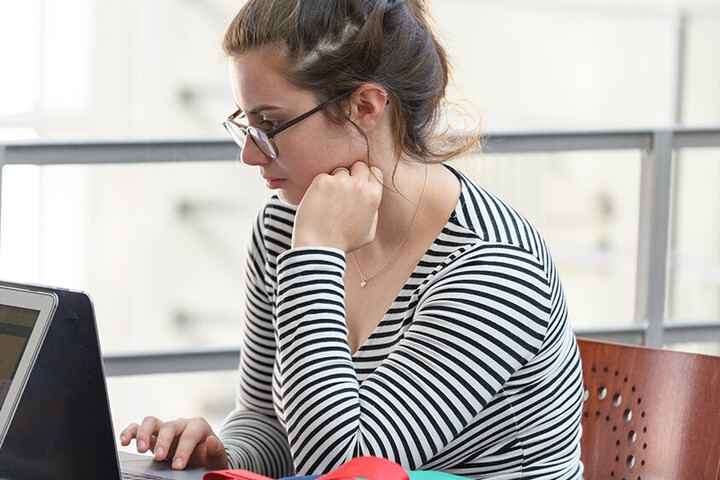Master Medien und Kommunikationswissenschaft:Digitale Kommunikation
Die Erforschung und Analyse von digitaler Kommunikation und ihrer Möglichkeiten, Varianten, Muster, Teilnehmerverhalten und Risiken: Darum geht es beim M.A. Medien- und Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation. Jeder Jahrgang konzentriert sich auf zwei ausgewählte Schwerpunktbereiche aus dem weiten Feld der digitalen Kommunikation und führt eigene empirische Forschungsprojekte durch. Kleine Gruppen und enger Kontakt zu den Lehrenden sorgen für ein optimales Lernklima. Ergänzt wird der Studiengang durch einen kleinen Wahlbereich an Kursen aus verwandten Fächern.
Auf einen Blick
| Studiendauer und -beginn | 4 Semester (Vollzeit), nur zum Herbst-/Wintersemester |
| Bewerbung | 10. April bis 31. Mai (Bewerbung starten) |
| Unterrichtssprache | Deutsch und Englisch |
| Zulassungsvoraussetzungen | Bachelorabschluss in Medien- und Kommunikationswissenschaft oder in einem verwandten Fach mit mindestens 2,5, Fachkenntnisse in MKW im Umfang von mindestens 28 ECTS sowie in einschlägigen Forschungsmethoden im Umfang von mindestens 8 ECTS. Alle Details stehen in der Auswahlsatzung. |
| Internationalität | Auslandssemester und/ |
| Studienumfang und -inhalte | 120 ECTS, davon ca. 105 ECTS in Medien- und Kommunikationswissenschaft und ca. 15 ECTS in einem zusätzlichen Wahlbereich |

Semesterbeitrag: 169 Euro (weitere Informationen)
Gebühren für Nicht-EU-Ausländer: 1.500 Euro
Gebühren für ein Zweitstudium: 650 Euro

Alle wichtigen Informationen
Schwerpunktthemen der Themenseminare
Schwerpunktthemen HWS 2024
Demokratiefeindliche Influencer*innen im Wahlkampf
Für 2025 steht die nächste Bundestagswahl ins Haus. Im Vorfeld der Wahl liegt der Fokus auf den demokratiefeindlichen Tendenzen, die die liberalen westlichen Gesellschaften nun bereits seit einigen Jahren beschäftigen. Gerade jüngere Wähler*innen zeigten sich bei den jüngsten Landtagswahlen empfänglich für anti-demokratische politische Tendenzen. Auf der Suche nach den kommunikativen Wurzeln für dieses Phänomen muss der Blick auf die Social-Media-Kommunikation gelegt werden. Auffällig ist die Existenz einer Vielzahl von politischen Influencer*innen-Accounts mit hohen Reichweiten auf besonders bei jüngeren Wähler*innen beliebten Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok, die populistische, demokratiefeindliche und bisweilen rechtsextreme Botschaften verbreiten. Im Zuge des Seminars wollen wir die von diesen Accounts verbreiteten Inhalte sichten und uns, literaturbasiert, Gedanken über deren Rolle für die Wahlentscheidung junger Menschen machen. Im anschließenden zweisemestrigen Forschungsprojekt untersuchen wir dann die Rolle demokratiefeindlicher Influencer*innen im Rahmen der Bundestagswahl 2025.
Das Seminar leitet Dr. Philipp Müller.
Algorithmenkompetenz
Algorithmen prägen unsere Nutzung digitaler Plattformen. In der Gesellschaft wird deshalb zunehmen der Ruf nach Algorithmenkompetenz der Nutzer*innen laut, damit Nutzer*innen algorithmische Prozesse selbstbestimmt bedienen können.
Im Seminar reflektieren wir den Forschungsstand zu Algorithmenkompetenz: Wir differenzieren verschiedene Funktionen von Algorithmen und Domänen, in denen diese eingesetzt werden. Wir lernen verschiedene Facetten des kompetenten Umgangs mit Algorithmen kennen. Wir reflektieren methodische Herangehensweisen an die Erforschung von Wissen über, Verständnis von und Adaption von Algorithmen durch die Nutzer*innen. Literaturbasiert ergründen wir Faktoren, die einen selbstbestimmten und zielführenden Umgang mit algorithmischen Prozessen stärken oder schwächen können. Wir diskutieren Interventionsmaßnahmen, die für die Schulung von Nutzer*innen eingesetzt werden.
Auf dieser Basis entwickeln wir im anschließenden zweisemestrigen Forschungsseminar eine eigene empirische Studie zu Einflüssen auf oder Effekten von Algorithmenkompetenz.
Das Seminar leitet Prof. Dr. Teresa Naab.
Schwerpunktthemen HWS 2023
Literarisches Lesen
Im Mittelpunkt dieses Schwerpunktthemen-Seminars steht das literarische Lesen, sowohl in Form der Rezeption von gedruckten Büchern als auch über digitale Geräte. In Vorbereitung des in den beiden folgenden Semestern sich anschließenden Projektseminars soll hier der Gegenstandsbereich anhand der folgenden Fragen exploriert lesen: Wer liest welche literarischen Texte in welche Form? Warum werden die entsprechenden Texte gelesen, wie werden sie verarbeitet und welche Wirkungen hat das literarische Lesen?
Das Seminar leitet Prof. Dr. Peter Vorderer.
Kinder/
Jugendliche und Vertrauen in Medien Vertrauen in Medien (auch: Glaubwürdigkeit der Medien) ist ein etabliertes Forschungsgebiet. Die Forschung richtet sich aber weit überwiegend auf Erwachsene und beschäftigt sich nur selten mit jüngeren Menschen. Damit ist eine der wichtigen Voraussetzungen für die Entwicklung von Vertrauenseinstellungen nur wenig erforscht. Hinzu kommt, dass sich der Konsum von Nachrichtenmedien bzw. allgemeiner von Informationsquellen mit dem Internet dramatisch geändert hat. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das Schwerpunktseminar nach einer grundsätzlichen Einführung in die Thematik „Vertrauen in Medien“ mit der bisherigen Forschung zu Vertrauen junger Menschen in Nachrichtenmedien bzw. Quellen politischer und gesellschaftlicher Informationen. Ziel ist ein systematischer Überblick und eine Einordnung der bisherigen Erkenntnisse wie auch die Benennung möglicher Forschungslücken. Zum Ende des Seminars werden wir über Forschungsideen reden, die im darauffolgenden zweisemestrigen Projektseminar behandelt werden könnten.
Das Seminar leitet Prof. Dr. Matthias Kohring.
Schwerpunktthemen HWS 2022
Cancel Culture
Mit dem Begriff „Cancel Culture“ werden Bestrebungen bezeichnet, einzelne Personen aufgrund angeblicher moralischer Verfehlungen aus der öffentlichen Kommunikation auszuschließen. Der Begriff ist aber nicht neutral, sondern ein politisches Schlagwort, mit dem diese Ausschluss-Bestrebungen grundsätzlich abgelehnt werden sollen. Aber ist der Ausschluss Einzelner von der öffentlichen Kommunikation nicht manchmal auch gerechtfertigt? Wo genau verläuft die Linie zwischen legitimer moralischer Kritik und schädlicher Empörungshysterie? Diesen Fragen wollen wir im Schwerpunktseminar anhand wissenschaftlicher Theorien und Studien sowie durch Einzelfallanalysen nachgehen. Dabei analysieren wir auch, ob die sozialen Netzwerkmedien zu einer Empörungsspirale in Echtzeit beitragen, die das gesellschaftliche Debattenklima vergiftet – und wie journalistische Redaktionen, die Netzwerkkonzerne und wir als einzelne Mediennutzer*innen mit „Cancel Culture“-Tendenzen umgehen können.
Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Hartmut Wessler in Zusammenarbeit mit Prof. Tanjev Schultz (Uni Mainz).
Wie ich mich selbst beeinflusste, als ich versuchte andere zu beeinflussen…
„Menschen rezipieren Medieninhalte und das hat verschiedentliche Auswirkungen auf sie.“ Auf dieser – hier natürlich stark vereinfachten – Logik basieren zahlreiche Medienwirkungsstudien. Sie blicken darauf, wie Menschen von Medieninhalten beeinflusst werden, die andere produziert haben. Unberücksichtigt bleibt häufig, dass Nutzer*innen sozialer Medien auch selbst Botschaften produzieren und sich dadurch selbst beeinflussen können. Beispielsweise stellen Nutzer*innen sich in sozialen Medien selbst dar, kommentieren gesellschaftliche Debatten oder liken Beiträge von anderen. Dadurch erzielen diese Nutzer*innen nicht nur Effekte bei anderen, sondern können sich auch selbst überzeugen, selbst mobilisieren, selbst besser fühlen u.v.m. Wir beschäftigen deshalb mit sog. Selbst-Effekten der Kommunikation in sozialen Medien. Wir sammeln theoretische und empirische Literatur, die Hinweise auf Selbst-Effekte gibt, diskutieren und systematisieren diese und wenden sie auf Beispiele aus der Praxis sozialer Medien an.
Das Seminar leitet Prof. Dr. Teresa Naab.
Schwerpunktthemen HWS 2021
Politisch informiert!?
Die Nachrichten- und Informationsnutzung hat sich mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Medienumgebung gewandelt. Statt Nachrichten um 20 Uhr vor dem heimischen Fernseher zu verfolgen oder die Tageszeitung beim Frühstück zu lesen, können wir heute überall und jederzeit aktuelle Nachrichten und Informationen über Social Media-Kanäle beziehen. Dies gibt uns das Gefühl, stets bestens informiert zu sein. Doch wie viel wissen wir am Ende des Tages tatsächlich über das politische Geschehen? Der Kurs widmet sich der politischen Informiertheit in der digitalen Mediengesellschaft und thematisiert hierfür unterschiedliche Rezeptionsmodi (z. B. incidental vs. intentional news exposure) und Praktiken (z. B. lesen, teilen, kommentieren) sowie Phänomene der algorithmischen und sozialen Selektion bei der Nachrichten- und Informationsnutzung. Aufbauend auf dem entsprechenden Forschungsstand werden verschiedene Fragen zur politischen Informiertheit in der digitalen Mediengesellschaft analysiert und diskutiert. Das Seminar wird geleitet von Vertr.-Prof. Sarah Geber.
„Wissenschaft im Netz“ / „Science on the net“
Für Wissenschaftskommunikation – sei es journalistische Wissenschaftsberichterstattung oder Hochschulöffentlichkeitsarbeit, seien es Foren zu (teils konflikthaften) Wissenschaftsthemen oder Blogs von einzelnen Wissenschaftler*innen – hat das Internet zumindest theoretisch ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, steht doch jetzt „genug Platz“ zur Verfügung und kann das breite Publikum an jeder Diskussion partizipieren. Vor diesem Hintergrund nehmen wir im Seminar nach einer grundsätzlichen Einführung in das Themenfeld Wissenschaftskommunikation eine Bestandsaufnahme von „Wissenschaft im Netz“ vor. Hierbei fragen wir nach Veränderungen der Wissenschaftskommunikation und öffentlicher Kommunikation über Wissenschaft (wozu übrigens auch wissenschaftliche Desinformation gehört) und diskutieren potenzielle Folgen für das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Matthias Kohring.
Schwerpunktthemen HWS 2020
Überwachung / Surveillance
Der Begriff „Überwachung“ bezeichnet das Sammeln und Verarbeiten personenbezogener Daten zum Zweck der Planung, Kontrolle und Verhaltenssteuerung. Mit der umfassenden Digitalisierung von Kommunikation hat dieses Phänomen eine neuartige gesellschaftliche Brisanz gewonnen. Jede Onlineaktivität führt in unterschiedlichem Maße zur Erhebung und Speicherung individueller Verhaltensspuren, die vernetzt und zur Prognose zukünftigen (individuellen) Verhaltens verwendet werden können. Wurde Überwachung ursprünglich im Rahmen staatlicher Kontrolle (und auch Fürsorge) betrachtet, stehen nun kommerzielle Formen der Überwachung und deren Risiken für freiheitliche Gesellschaften und individuelle Schutzrechte wie z. B. Privatheit im Mittelpunkt.
In diesem Schwerpunktseminar beschäftigen wir uns mit der Klärung der zentralen Begriffe, wir versuchen uns an einer Bestandsaufnahme des Phänomens „Überwachung“ und wir diskutieren, wie wir selbst die Folgen von Überwachung für das Individuum und die Gesellschaft bewerten. Zum Ende des Seminars werden wir über mögliche Forschungsideen reden, die im darauffolgenden zweisemestrigen Projektseminar behandelt werden könnten. Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Matthias Kohring.
Die demokratische Qualität von Online-Debatten / The democratic quality of online debate
Nach einer Phase der euphorischen Erwartung an die Wiederbelebung der Demokratie durch das Internet überwiegt heute die Skepsis: Stichworte wie Hate Speech, Fake News und politische Polarisierung nähren Zweifel, ob Online-Kommunikation überhaupt zu einer vielfältigen, respektvollen und fairen öffentlichen Auseinandersetzung beitragen kann. Das Schwerpunktseminar bilanziert einerseits, was wir inzwischen über die demokratische Qualität von Online-Debatten wissen – sei es in den Kommentarspalten von Nachrichtenseiten, auf Twitter, Facebook oder Whatsapp. Zum anderen fragt das Seminar lösungsorientiert, wie kommunikative Interventionen von NutzerInnen, eine verbesserte Medienregulierung oder veränderte Softwarelösungen die Qualität öffentliche Auseinandersetzungen steigern können. Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Hartmut Wessler.
Schwerpunktthemen HWS 2019
Misstrauen – und die Medien / Distrust – and the media
Misstrauen hat in der Vertrauensforschung immer eine untergeordnete Rolle gespielt. In letzter Zeit erfährt das Konzept etwas mehr an Aufmerksamkeit, vor allem im Hinblick auf Politik und Medien. Dabei wird allerdings deutlich, dass der Begriff unterschiedlich verstanden und gemessen wird. Das Seminar beschäftigt sich zunächst damit, was man unter Misstrauen überhaupt verstehen kann und wozu man dieses Konzept zusätzlich zu (fehlendem) Vertrauen benötigen könnte. Der Titel des Seminars soll ausdrücken, dass Nachrichtenmedien sowohl Gegenstand von Misstrauen sind als auch Misstrauen in andere gesellschaftliche Bereiche befördern können. Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Matthias Kohring und Prof. Dr. Angela Keppler.
Digitales Lesen (am Beispiel fiktionaler Literatur sowie der Tageszeitung) / Digital Reading (of fiction and newspapers)
Das Schwerpunktseminar wird sich mit der Frage beschäftigen, wer heute wie häufig und wie intensiv welche Inhalte (von Tageszeitungen einerseits und von fiktionaler Literatur andererseits) warum liest. Dabei geht es zum einen um eine Bestandsaufnahme sowie um Veränderungen gegenüber der analogen Lektüre, aber auch um die Frage, wie die möglichen Veränderungen erklärt werden können. Das Seminar wird geleitet von Prof. Dr. Peter Vorderer.
Beratung und Kontakt